💊 KI in der Pharmazie blufft, Wissenschaftler schlagen Alarm
Im medizinischen Bereich stellen Proteine bevorzugte Ziele für Medikamente dar. Diese biologischen Makromoleküle, die aus Aminosäureketten bestehen, nehmen dreidimensionale Strukturen an, die ihre Funktion bestimmen. Die Entschlüsselung dieser molekularen Architekturen ist ein grundlegender Schritt zur Entwicklung innovativer Behandlungen. Seit einigen Jahren hat das Auftreten von Algorithmen wie AlphaFold diesen Ansatz revolutioniert, indem sie die Vorhersage der Proteinstruktur anhand ihrer genetischen Sequenz ermöglichen.
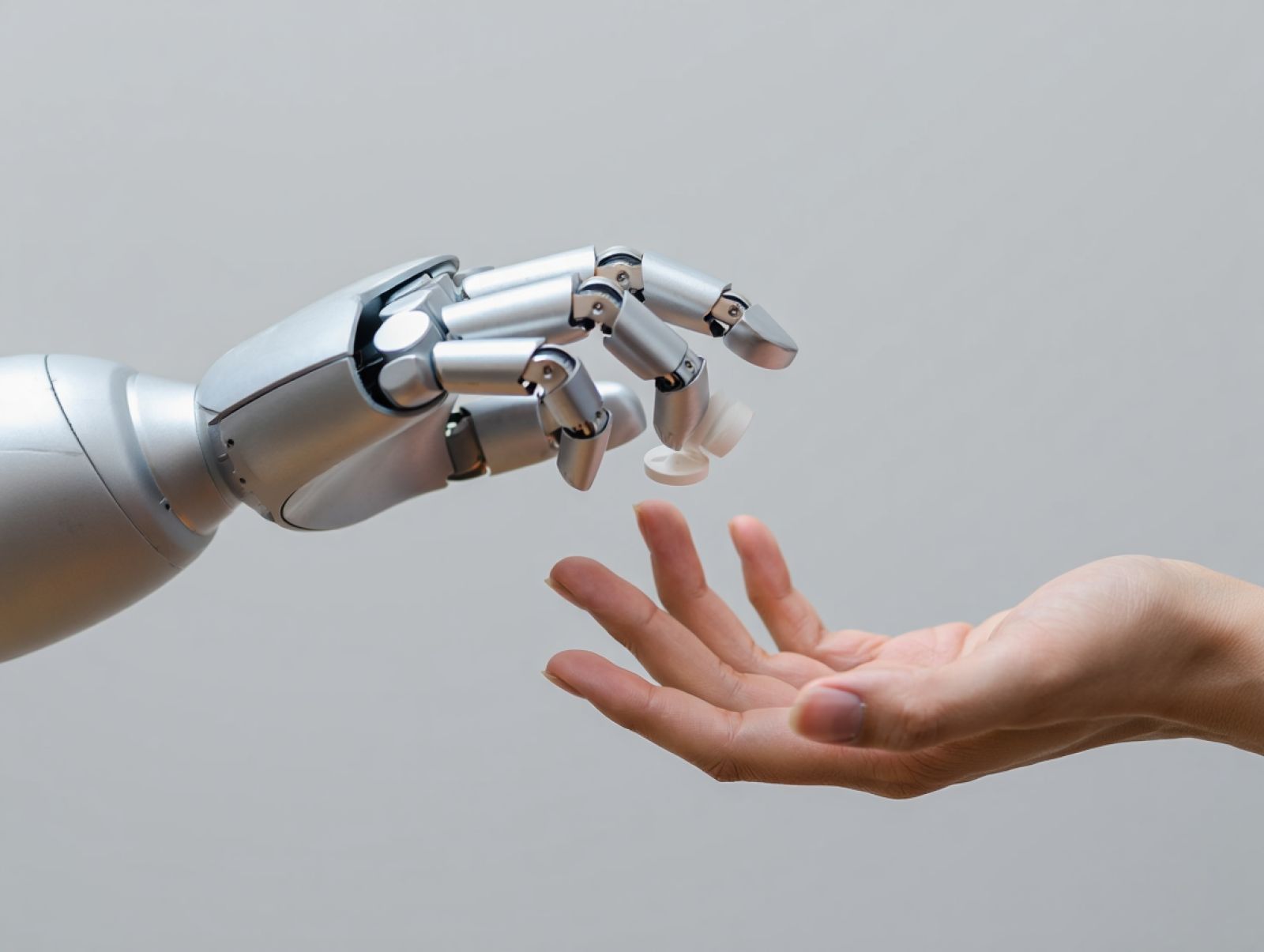
Die neuesten Versionen dieser Modelle gehen noch weiter, indem sie simulieren, wie Proteine mit verschiedenen Molekülen interagieren, insbesondere mit pharmazeutischen Wirkstoffen. Professor Markus Lill und sein Team haben jedoch bemerkt, dass die angekündigten Erfolgsquoten ungewöhnlich hoch erschienen. Diese Beobachtung führte zu dem Verdacht, dass die künstlichen Intelligenzen eher durch Mustererkennung als durch gründliche physikalische Analyse der molekularen Wechselwirkungen funktionieren könnten.
Um diese Hypothese zu überprüfen, modifizierten die Wissenschaftler künstlich Hunderte von Proteinen, indem sie gezielt deren Bindungsstellen veränderten. Sie erstellten Aminosäuresequenzen mit radikal unterschiedlichen elektrischen Ladungsverteilungen oder blockierten sogar vollständig die Interaktionsbereiche. Trotz dieser signifikanten Veränderungen sagten die KI-Modelle weiterhin die gleichen Strukturen voraus, als ob die Modifikationen nicht existierten. Ähnliche Tests an Liganden bestätigten diesen Trend.
Die Forscher stellten fest, dass in mehr als der Hälfte der Fälle die Vorhersagen trotz der eingeführten Veränderungen unverändert blieben. Diese kognitive Starrheit wird besonders problematisch, wenn die untersuchten Proteine nur geringe Ähnlichkeit mit denen aufweisen, die für das Training der Algorithmen verwendet wurden. Doch genau diese originellen Strukturen könnten den Weg zu wirklich innovativen Medikamenten ebnen, so das Forschungsteam.
Angesichts dieser Einschränkungen empfehlen die Wissenschaftler einen vorsichtigen Ansatz, der systematisch experimentelle Validierungen integriert. Sie befürworten auch die Entwicklung neuer Algorithmengenerationen, die ausdrücklich die Gesetze der Chemie und Physik einbeziehen. Solche hybriden Modelle könnten zuverlässigere Vorhersagen für noch wenig verstandene Proteinstrukturen liefern, die möglicherweise neue therapeutische Ansätze bergen.