Forscher der Stanford University haben ein Implantat für Patienten mit schweren Lähmungen entwickelt. Ihre in Cell veröffentlichte Arbeit markiert einen wichtigen Schritt hin zu einer neuartigen Kommunikation.
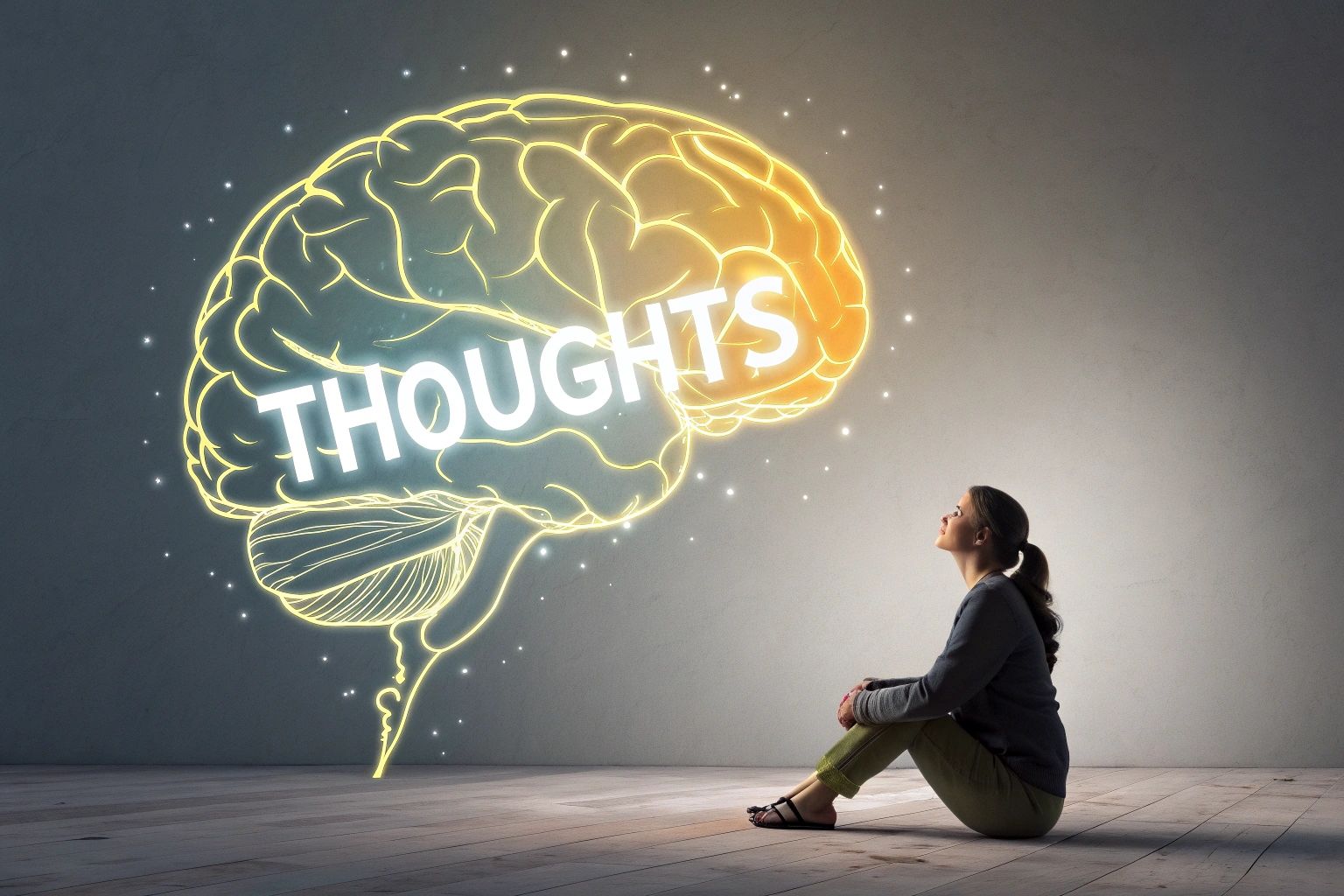
Funktionsweise der Gehirn-Computer-Schnittstelle
Das Implantat erfasst die elektrische Aktivität in der Gehirnregion des motorischen Cortex. Dieses Gebiet wird sowohl bei versuchter Sprache als auch beim bloßen Vorstellen des Sprechens (dem "inneren Gedanken") aktiv. Die erzeugten neuronalen Signale weisen Ähnlichkeiten, aber auch einen entscheidenden Unterschied auf.
Versuchtes Sprechen erfordert eine bewusste muskuläre Anstrengung, selbst wenn sie minimal ist. Für Menschen mit schweren motorischen Einschränkungen ist diese Anstrengung sehr ermüdend. Es erfordert intensive Konzentration, um oft gelähmte Muskeln zu aktivieren. Der innere Monolog oder die Vorstellung von Sprache erzeugt hingegen viel schwächere Signale. Er erfordert keine muskuläre Anspannung oder Artikulationsbemühung. Dieses Fehlen physischer Einschränkung macht ihn für den Nutzer weitaus weniger anstrengend.
Das System wurde daher speziell auf diese Signale des inneren Gedankens trainiert. Eine künstliche Intelligenz decodiert die Signale und identifiziert die vom Nutzer vorgestellten Phoneme. Ein Sprachalgorithmus setzt anschließend die vollständigen Wörter und Sätze zusammen. Der verfügbare Wortschatz übersteigt 125.000 Wörter.
Dieser Ansatz ermöglicht eine wesentlich komfortablere und nachhaltigere Kommunikation. Die Wiedergabegenauigkeit erreicht in Tests 74 %. Diese Leistung entspricht den existierenden Systemen, die auf versuchtem Sprechen basieren, und die Verarbeitungsgeschwindigkeit ermöglicht einen nahezu konversationellen Austausch.
Ein Gedanke, geschützt durch... Passwort
Das System benötigt eine bewusste Aktivierung durch den Nutzer. Ein zuvor festgelegter "Passwort"-Satz muss gedacht werden, um die Transkription auszulösen. Diese Passwort-Sequenz bleibt persönlich und vertraulich.
Die Erkennung dieses "Schlüsselsatzes" erreicht eine Zuverlässigkeit von 98 %. Diese Sicherheit verhindert das versehentliche Auslesen privater Gedanken: Das Gerät bleibt ohne diese neuronale Autorisierung inaktiv.
Dieser Ansatz geht auf die ethischen Bedenken ein, die diese Technologien aufwerfen. Er gewährleistet die vollständige Kontrolle durch die nutzende Person, wodurch Autonomie und Privatsphäre gewahrt bleiben.